-
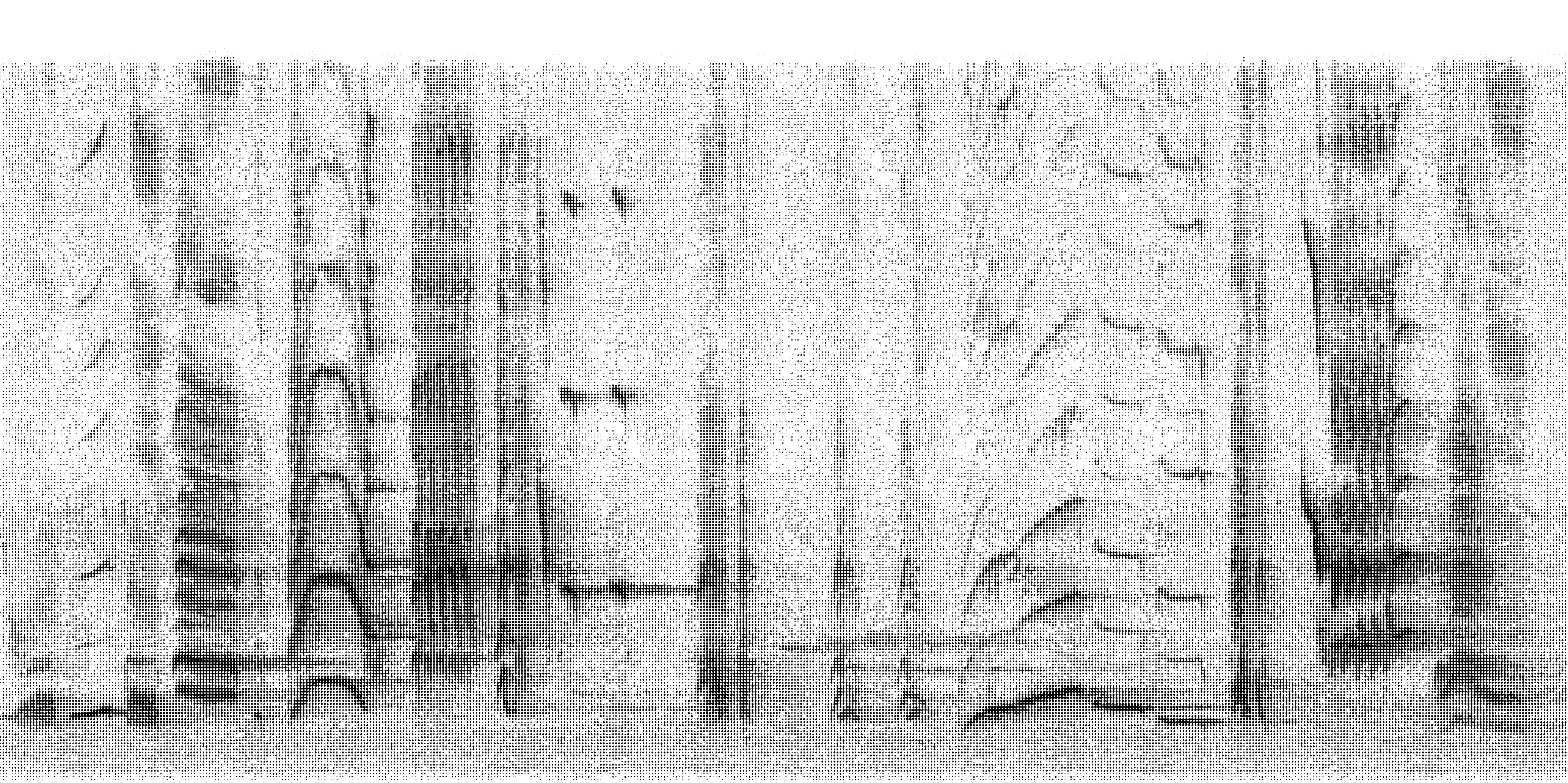
Amsel
-

Bachstelze
-
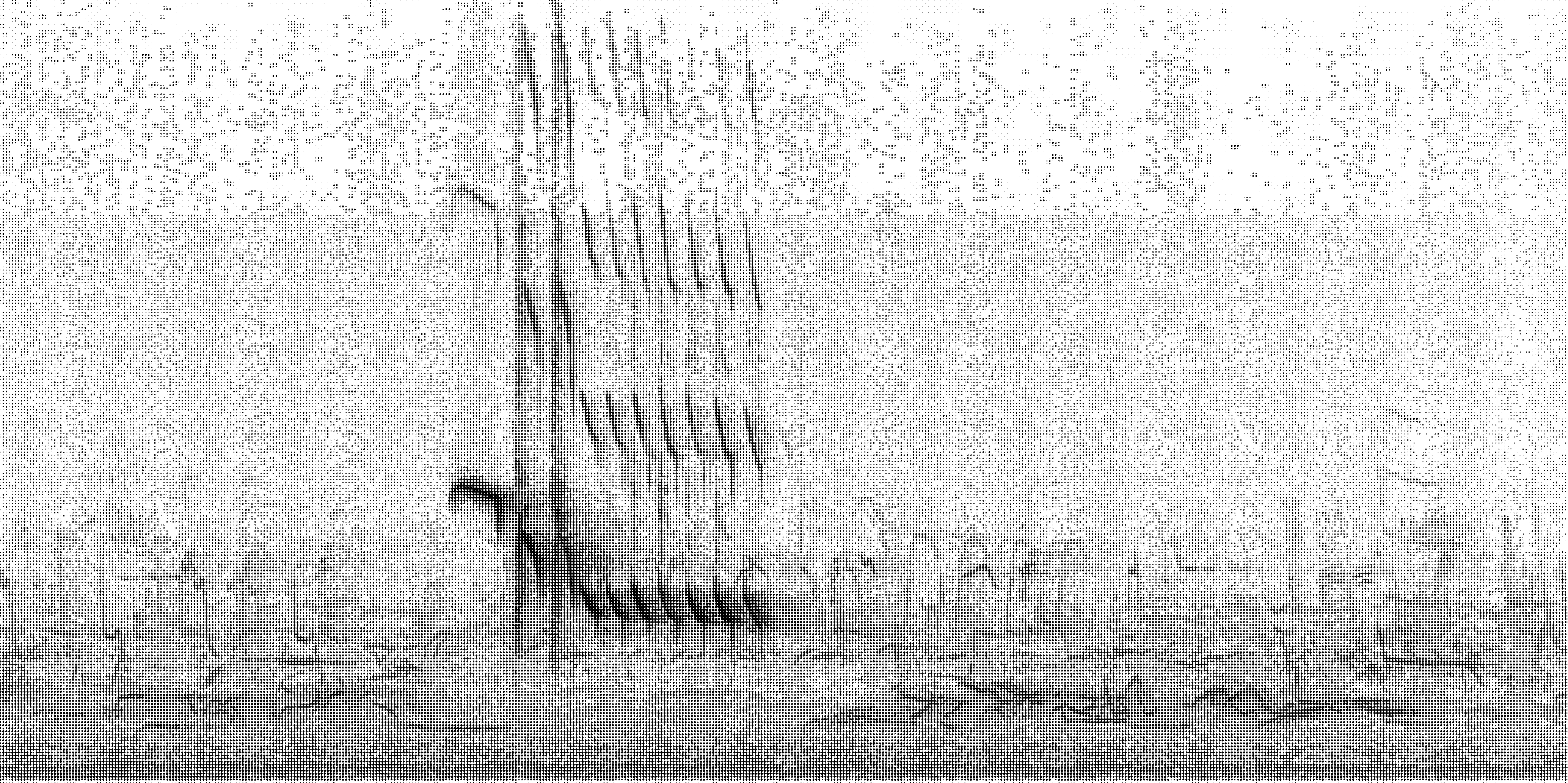
Blaumeise
-

Buchfink
-
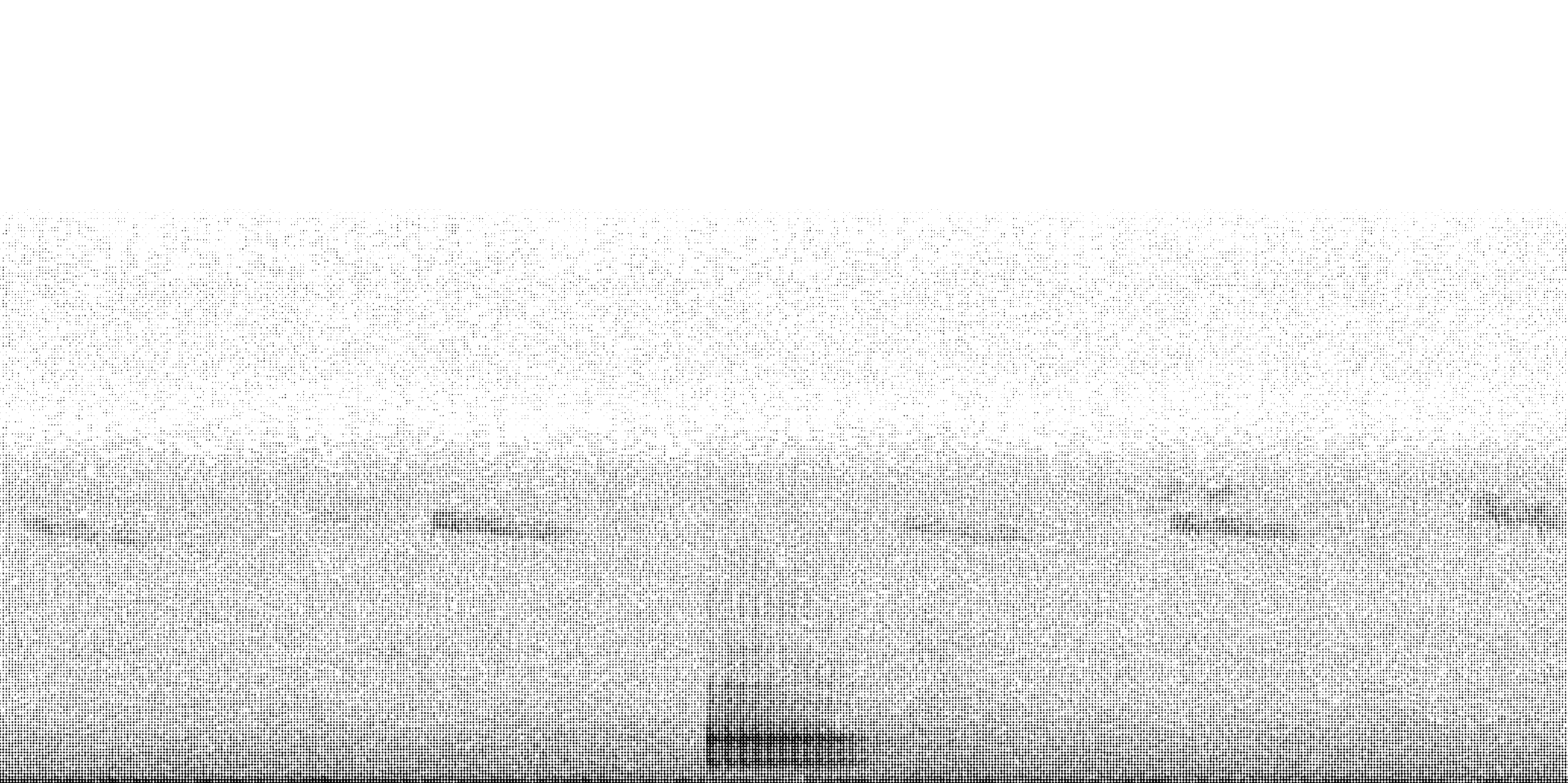
Buntspecht
-
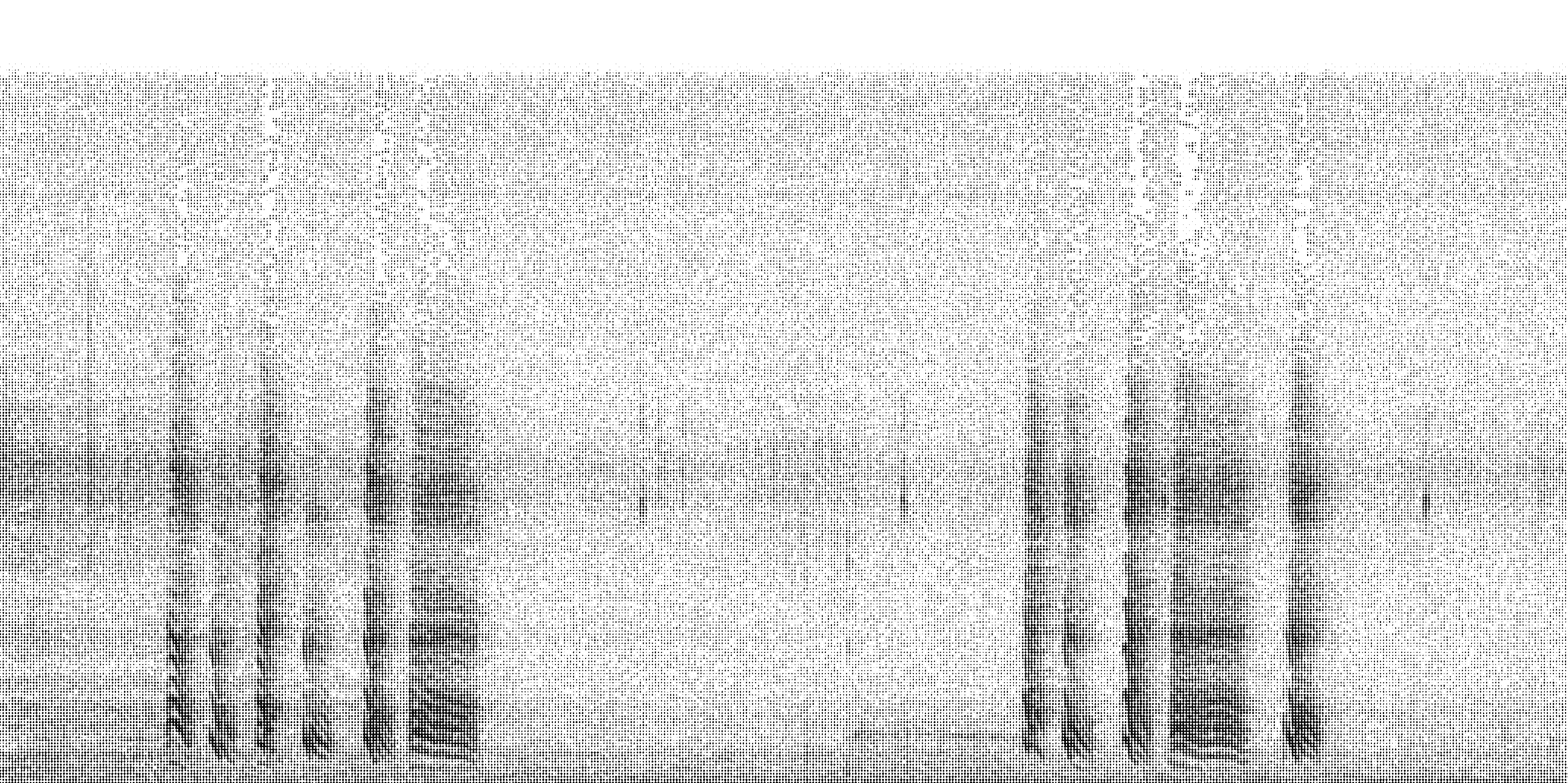
Dohle
-
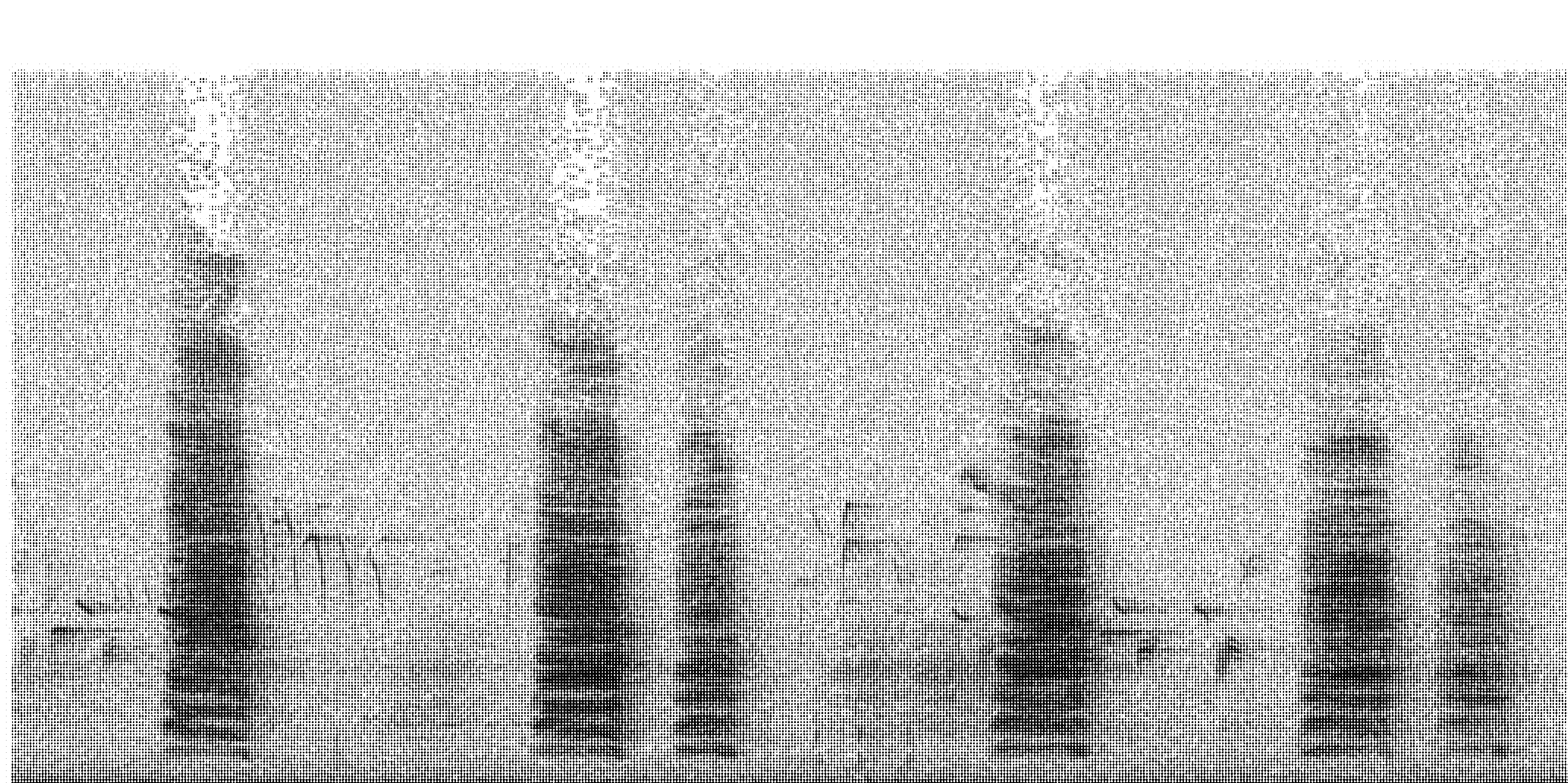
Eichelhäher
-

Elster
-
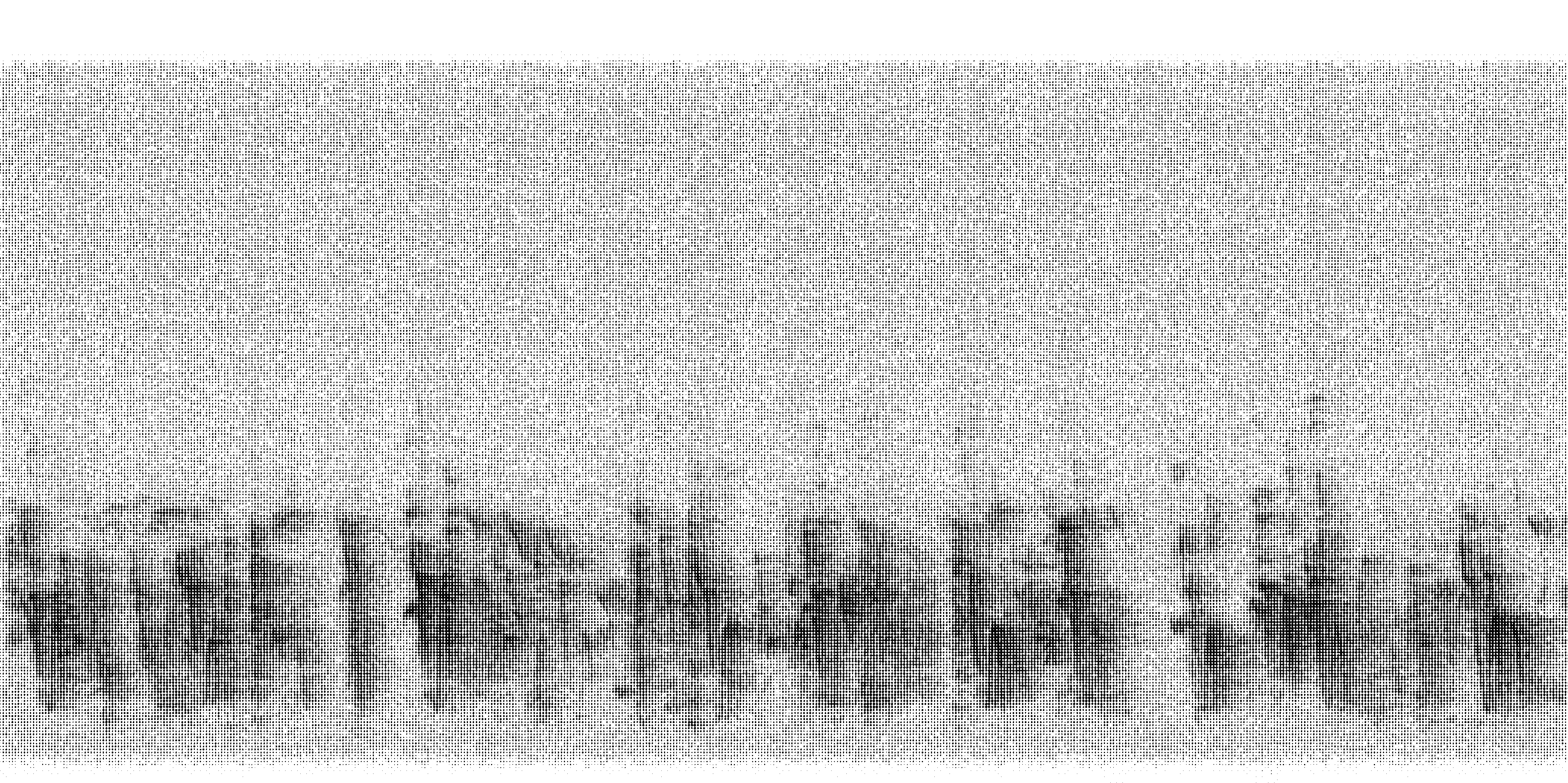
Feldsperling
-
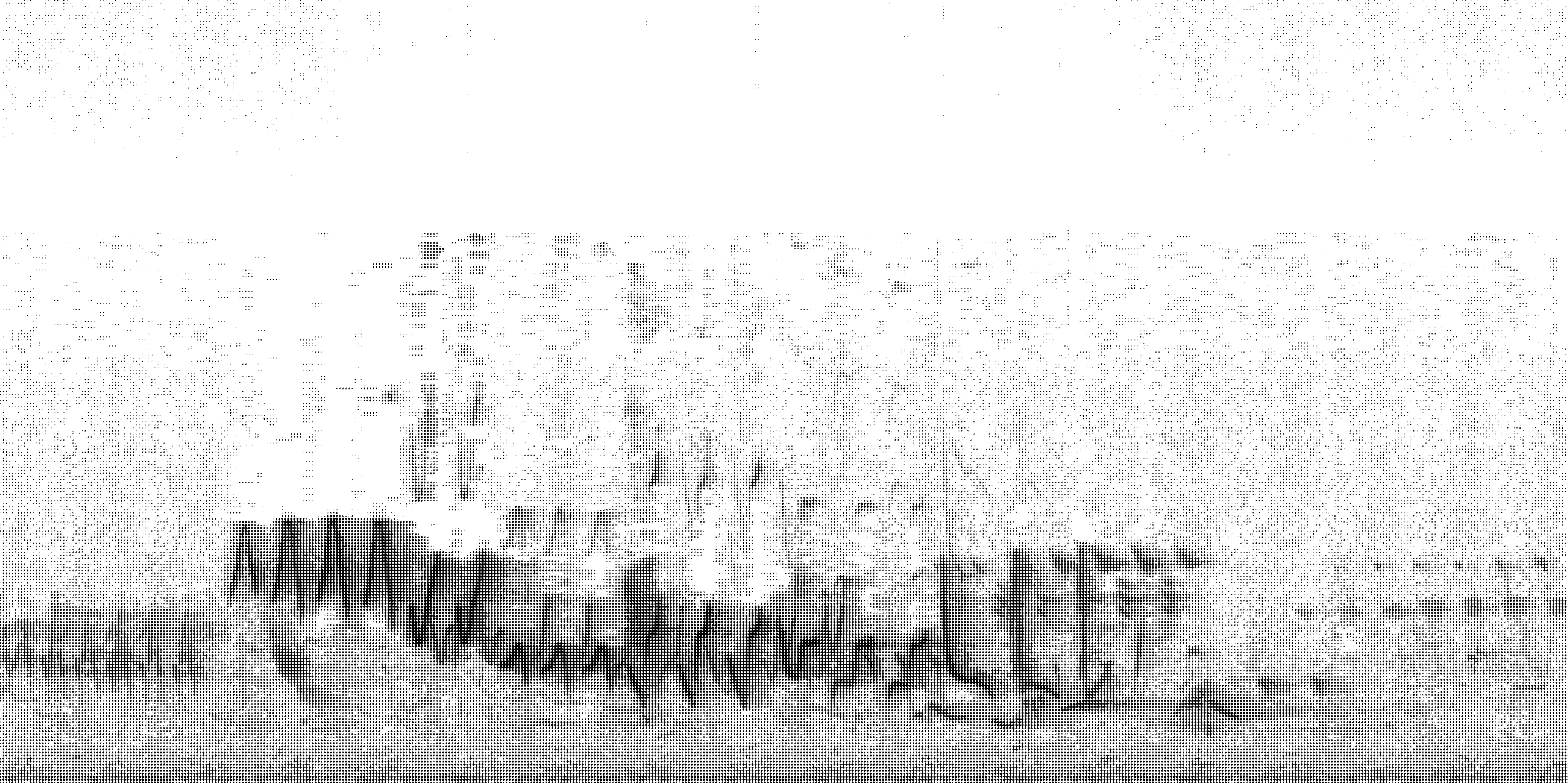
Fitis
-

Gartenbaumläufer
-
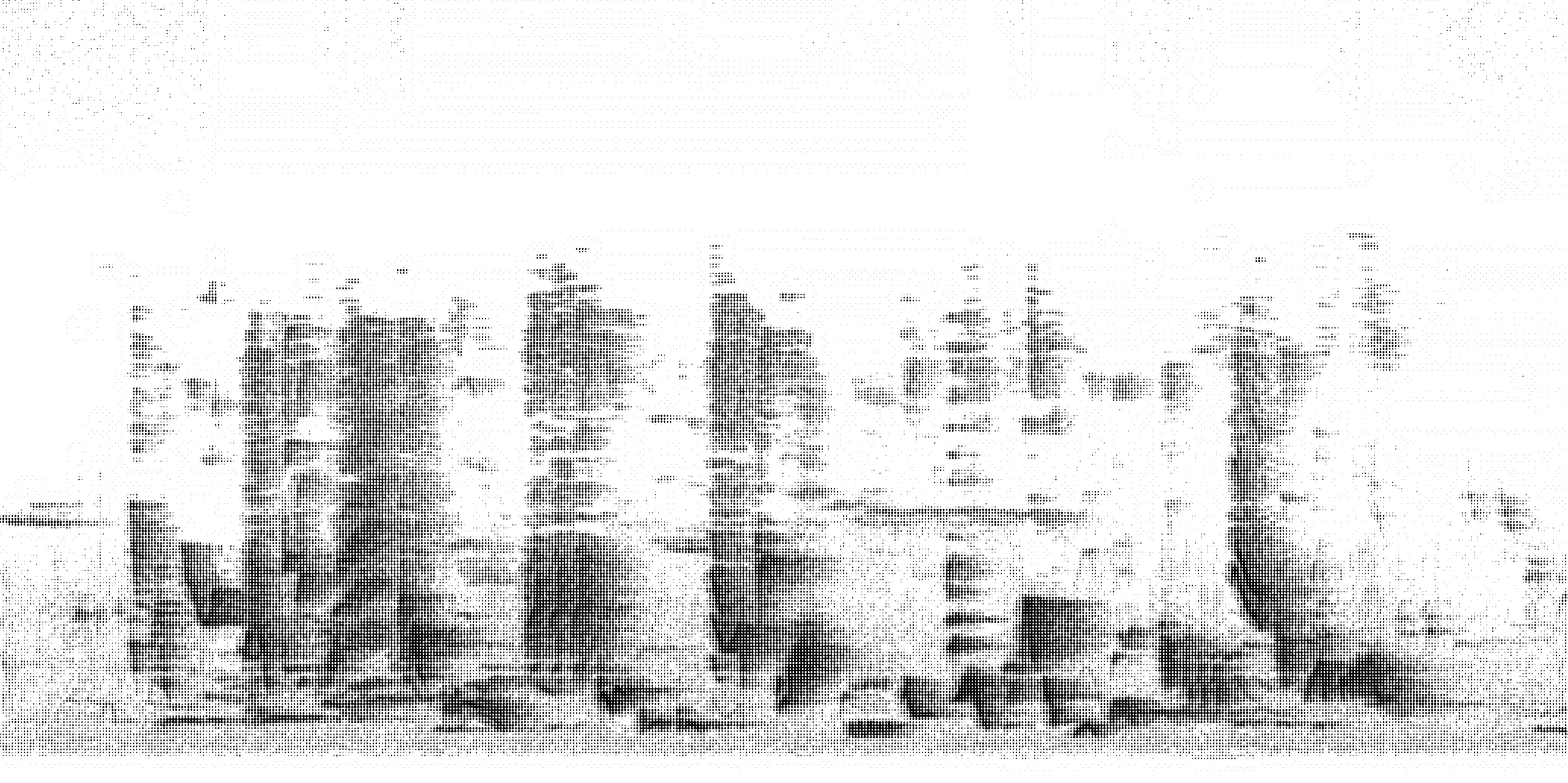
Gartengrasmücke
-

Gartenrotschwanz
-
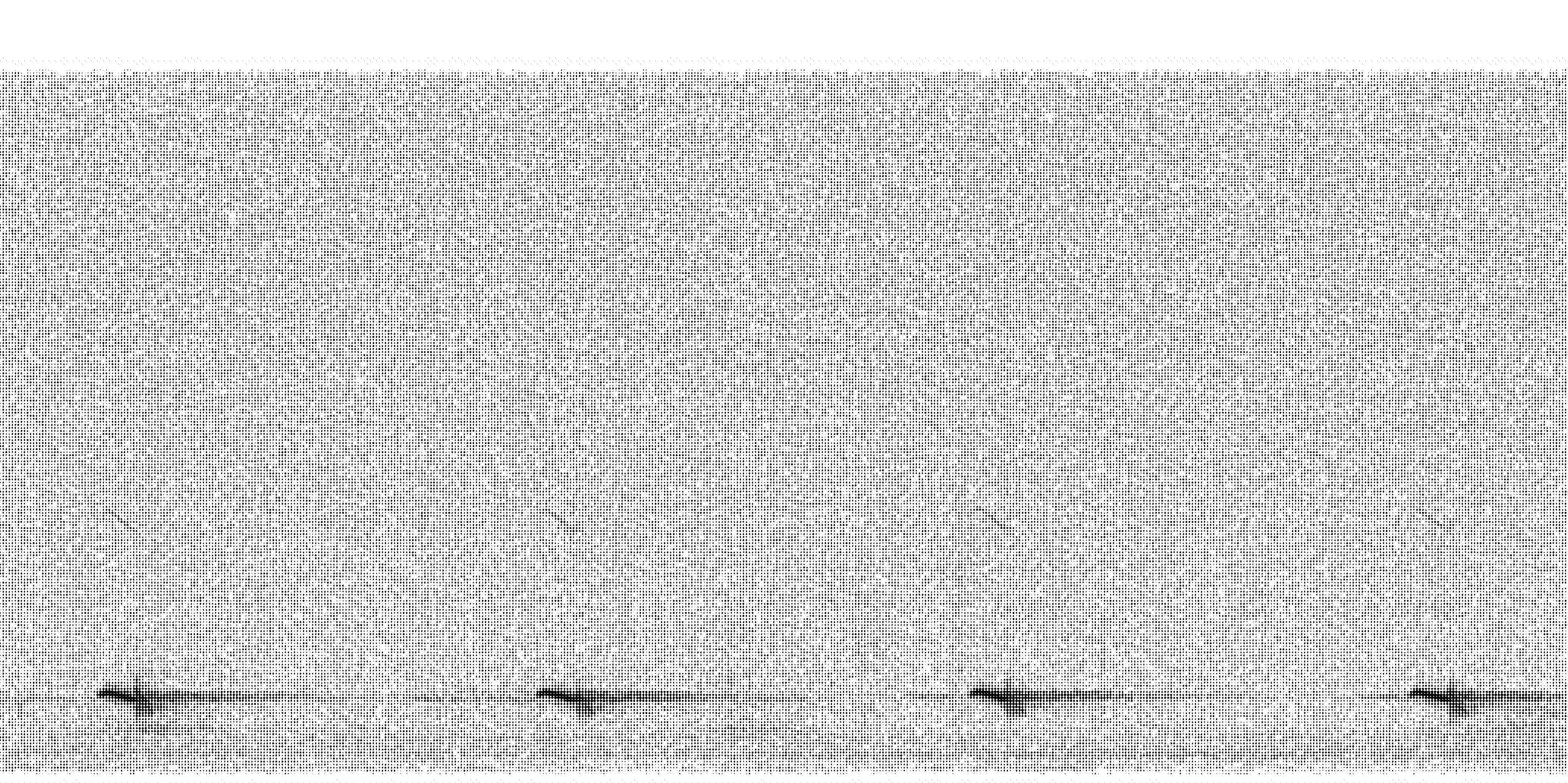
Gimpel
-
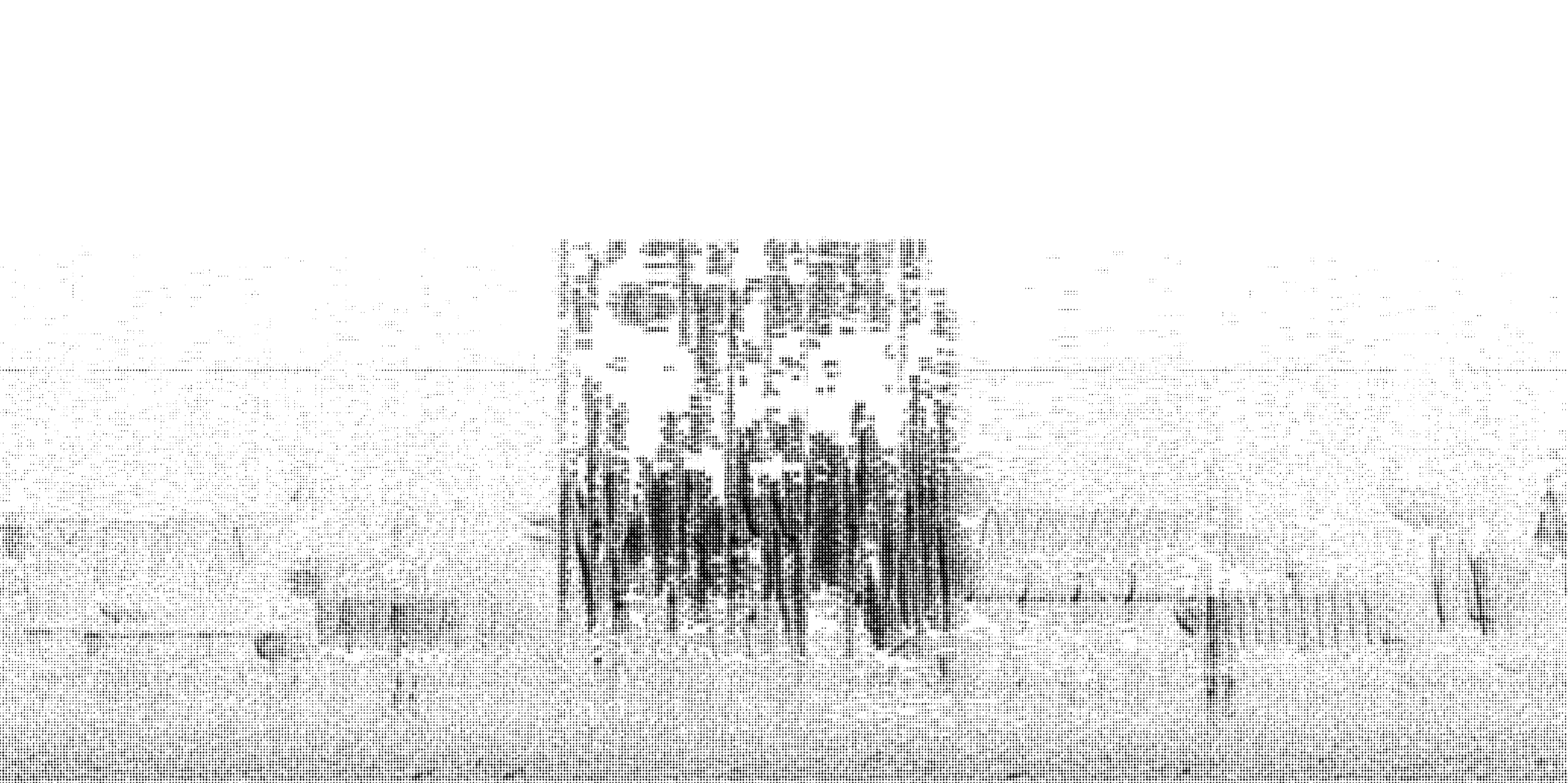
Girlitz
-

Goldammer
-

Grauschnäpper
-

Grünfink
-

Hausrotschwanz
-
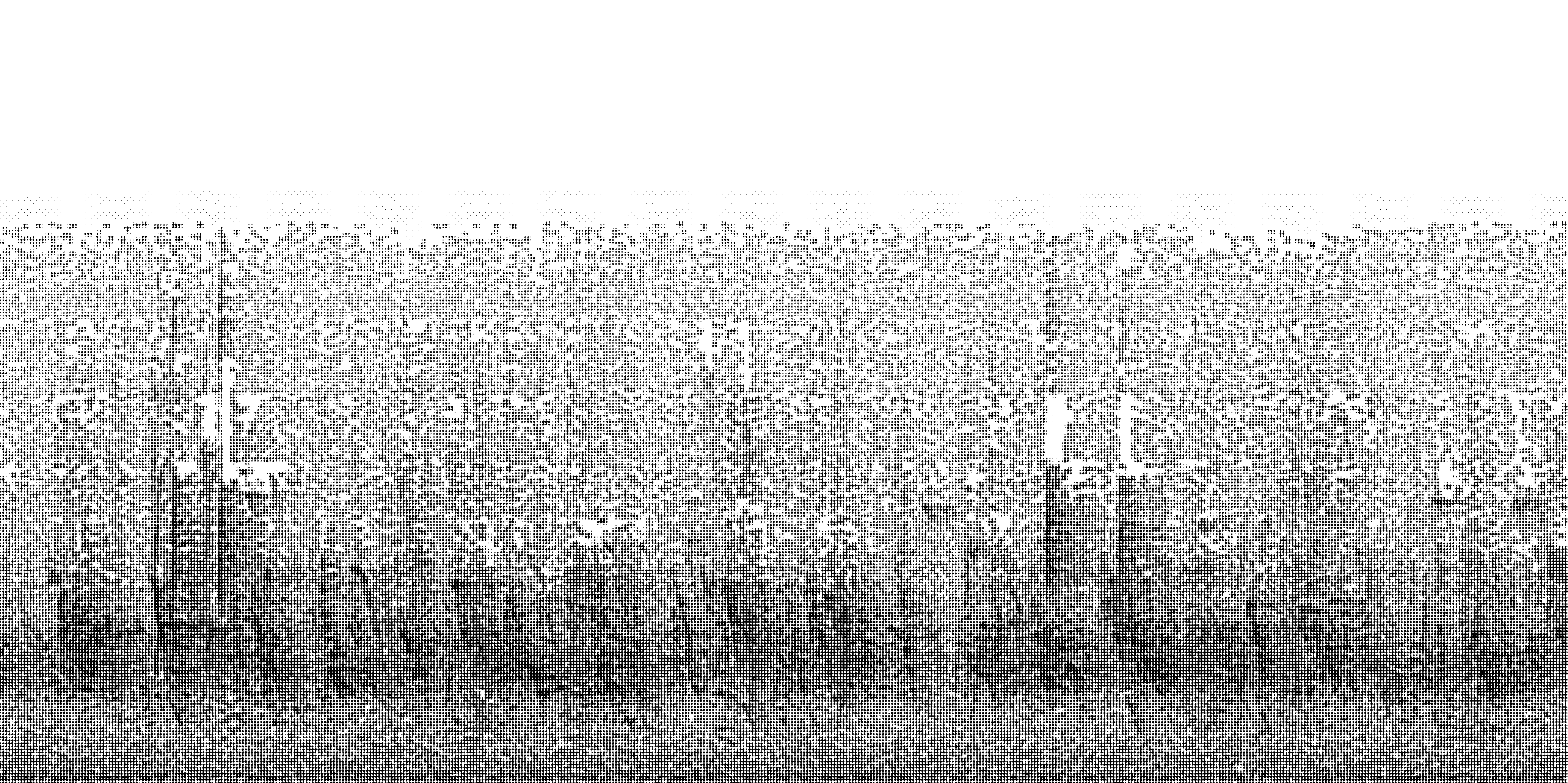
Haussperling
-

Heckenbraunelle
-
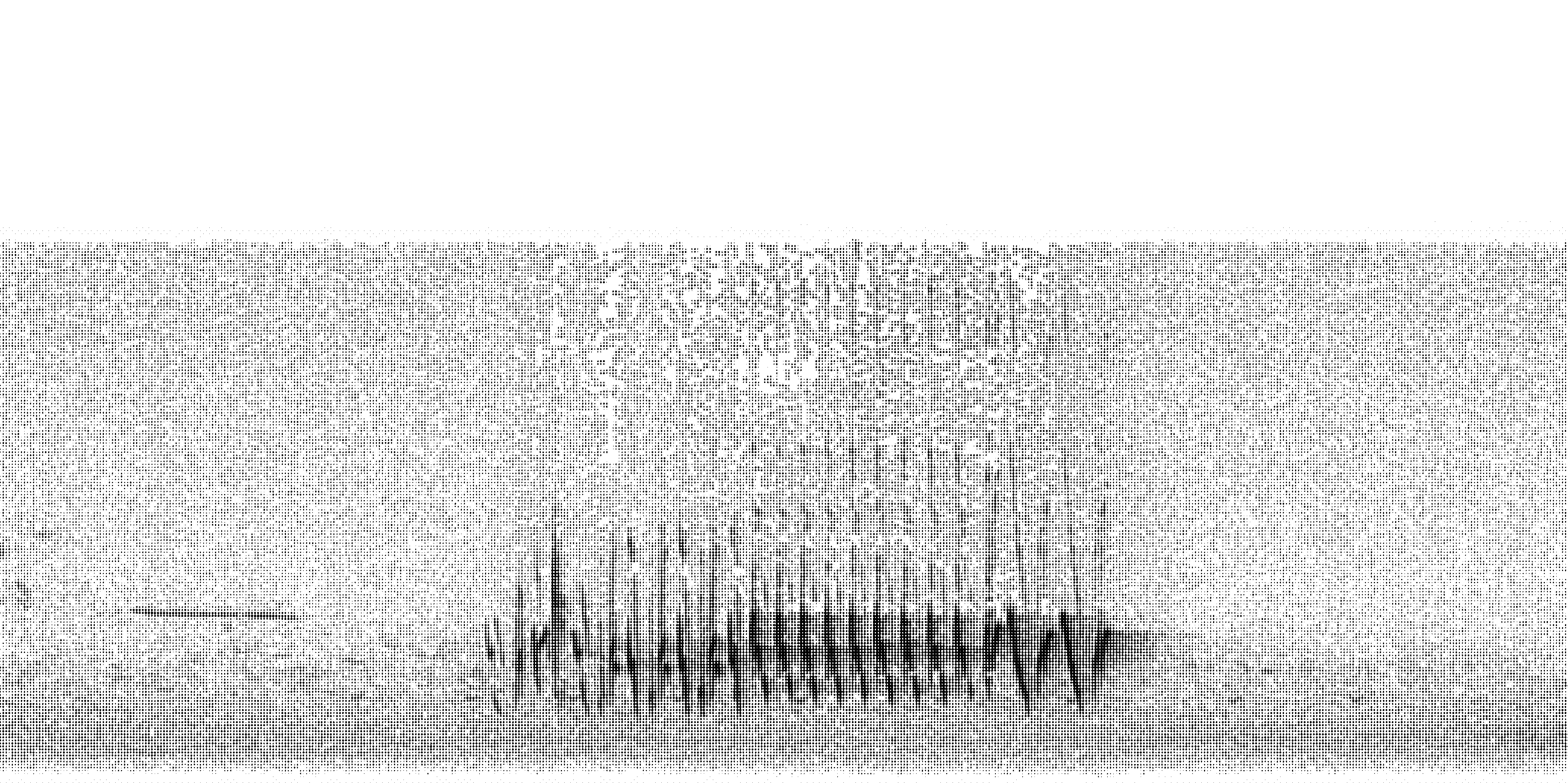
Klappergrasmücke
-
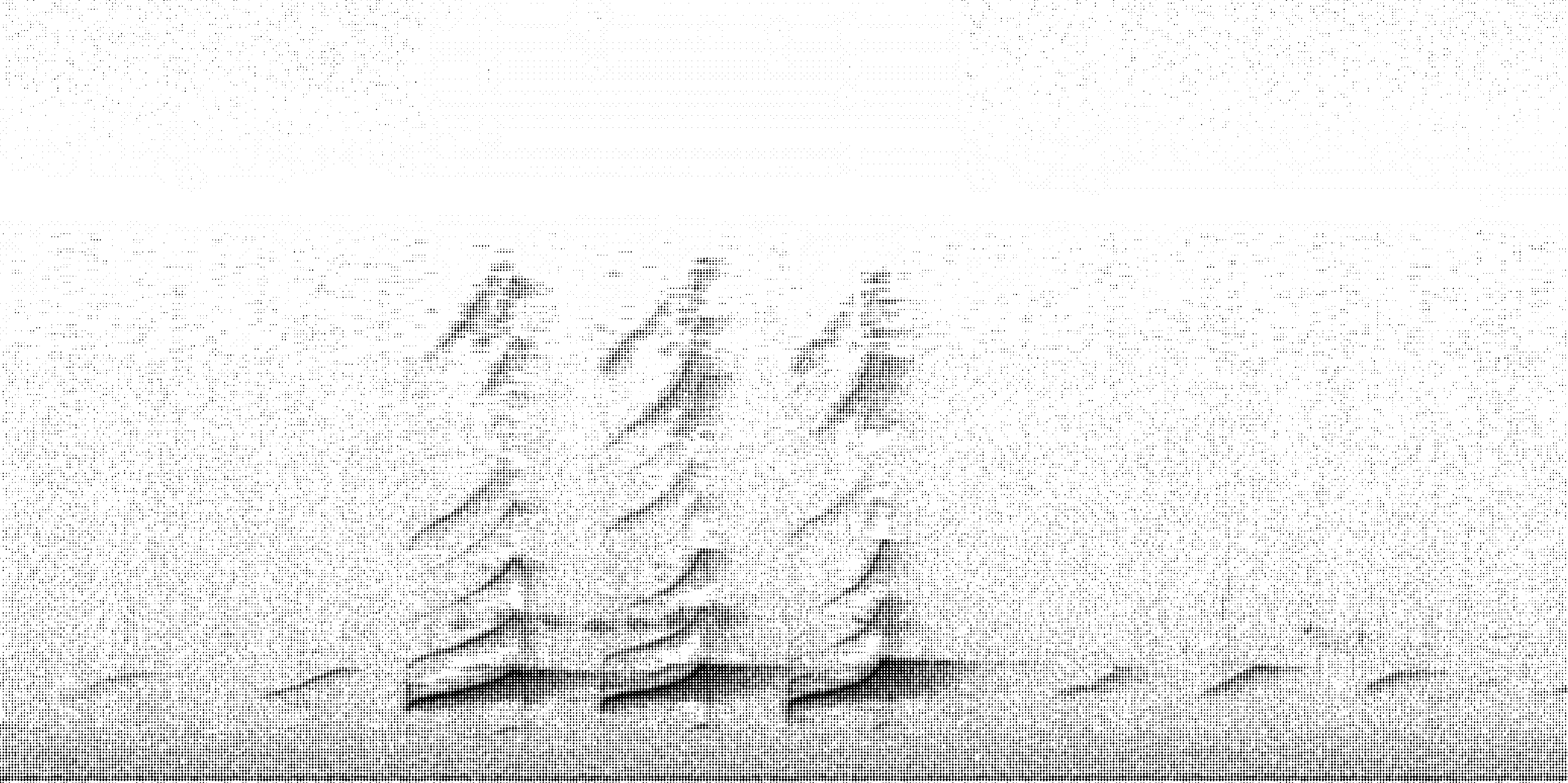
Kleiber
-
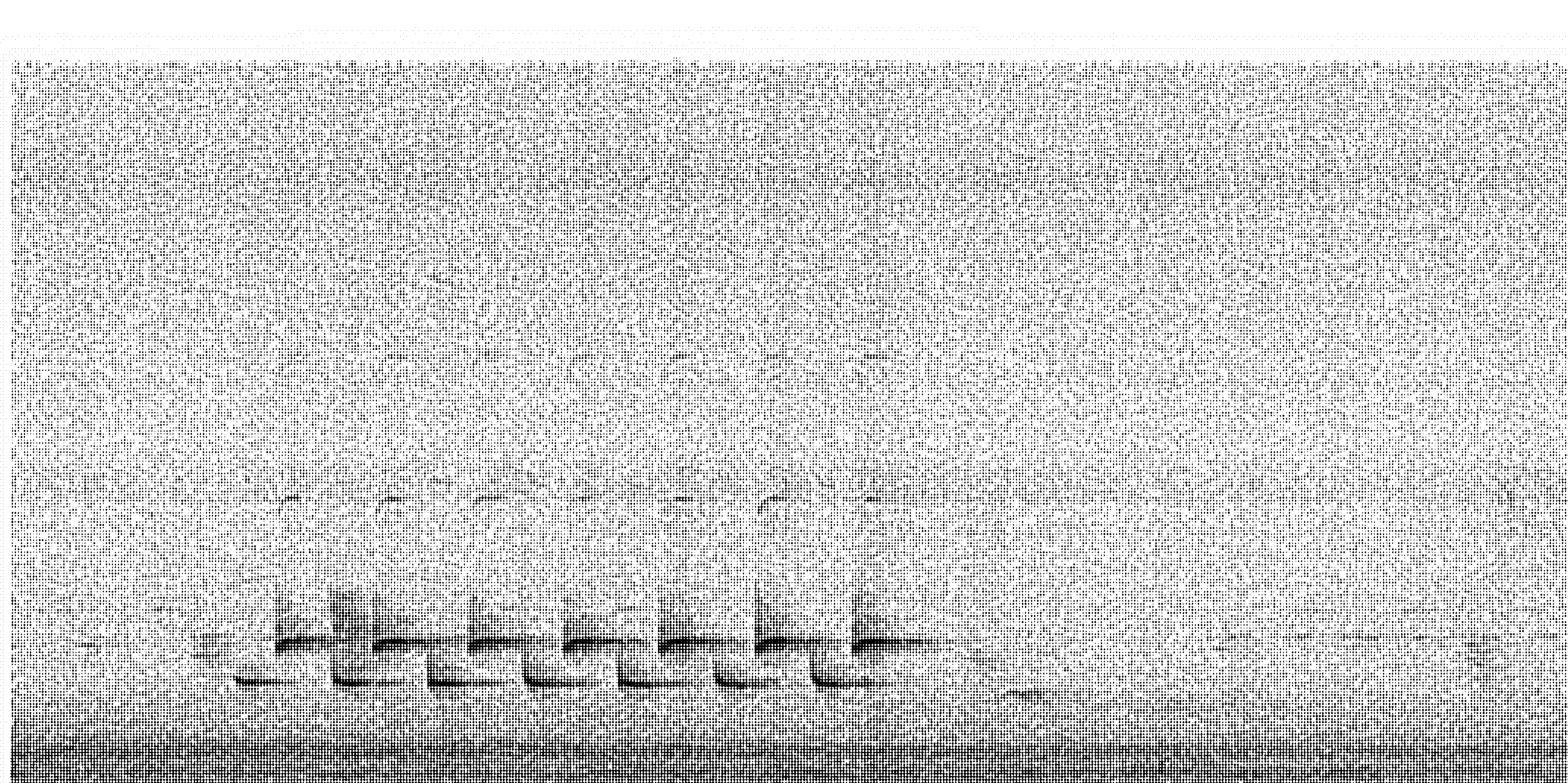
Kohlmeise
-
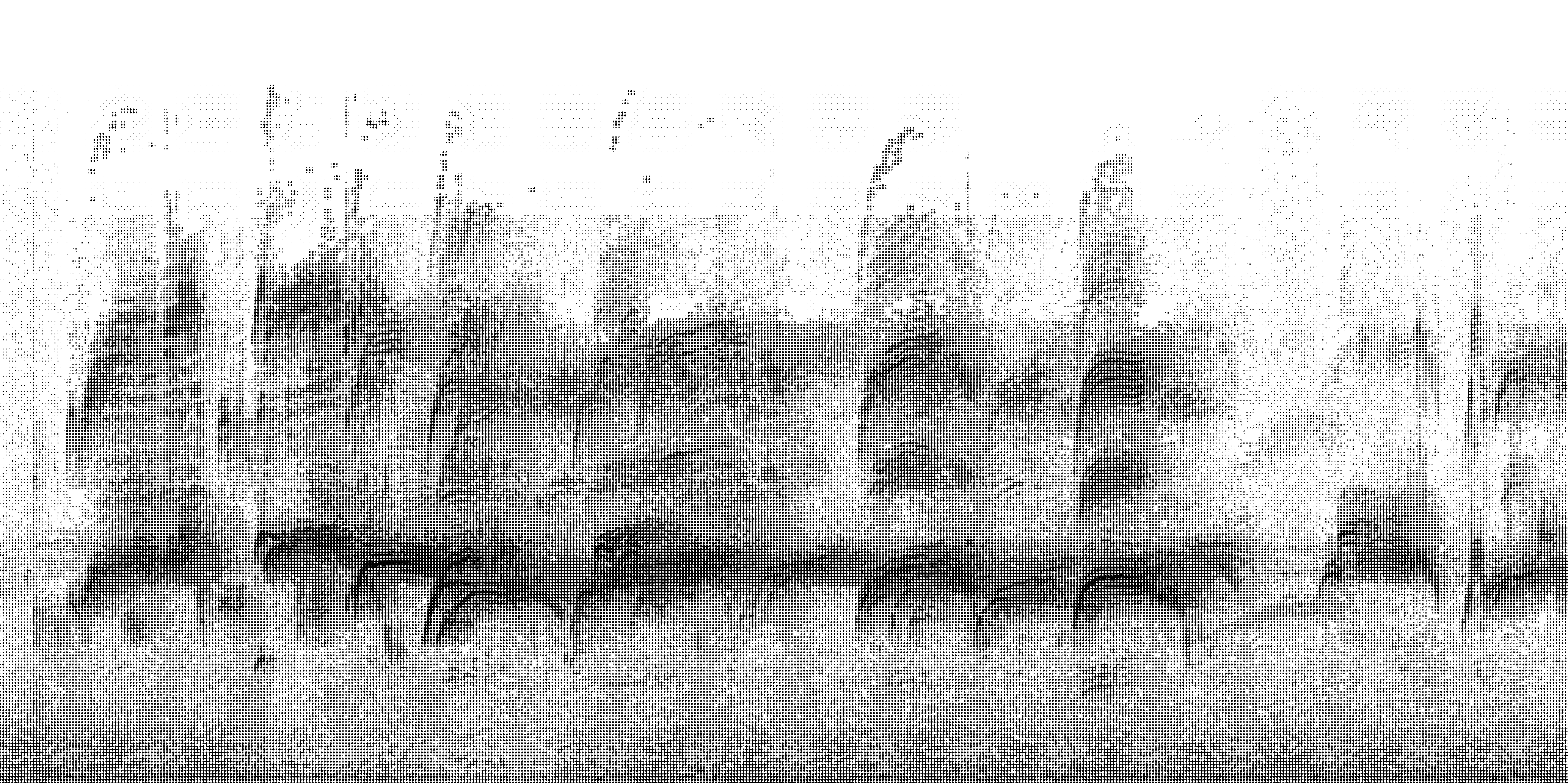
Mauersegler
-
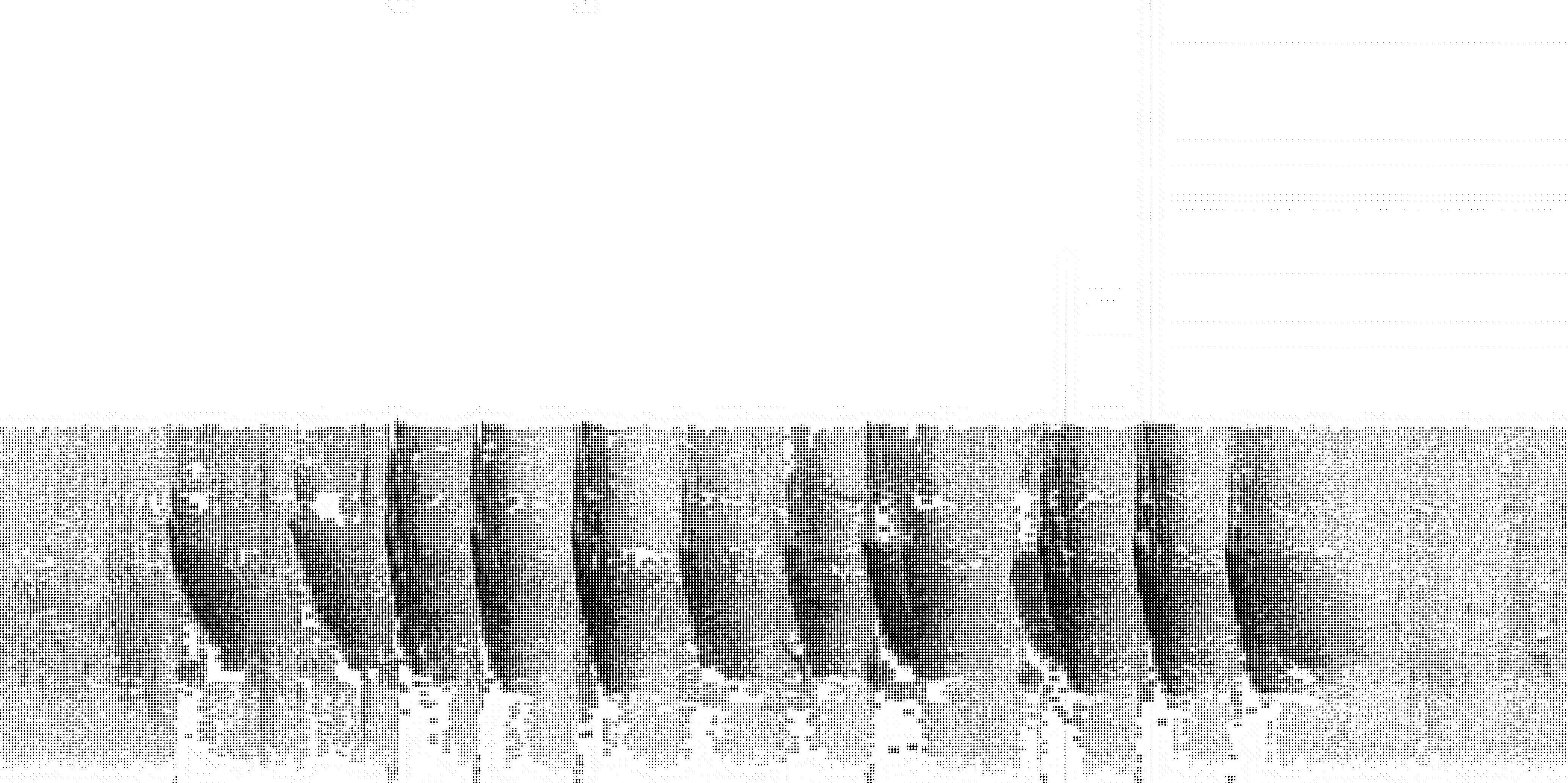
Mehlschwalbe
-
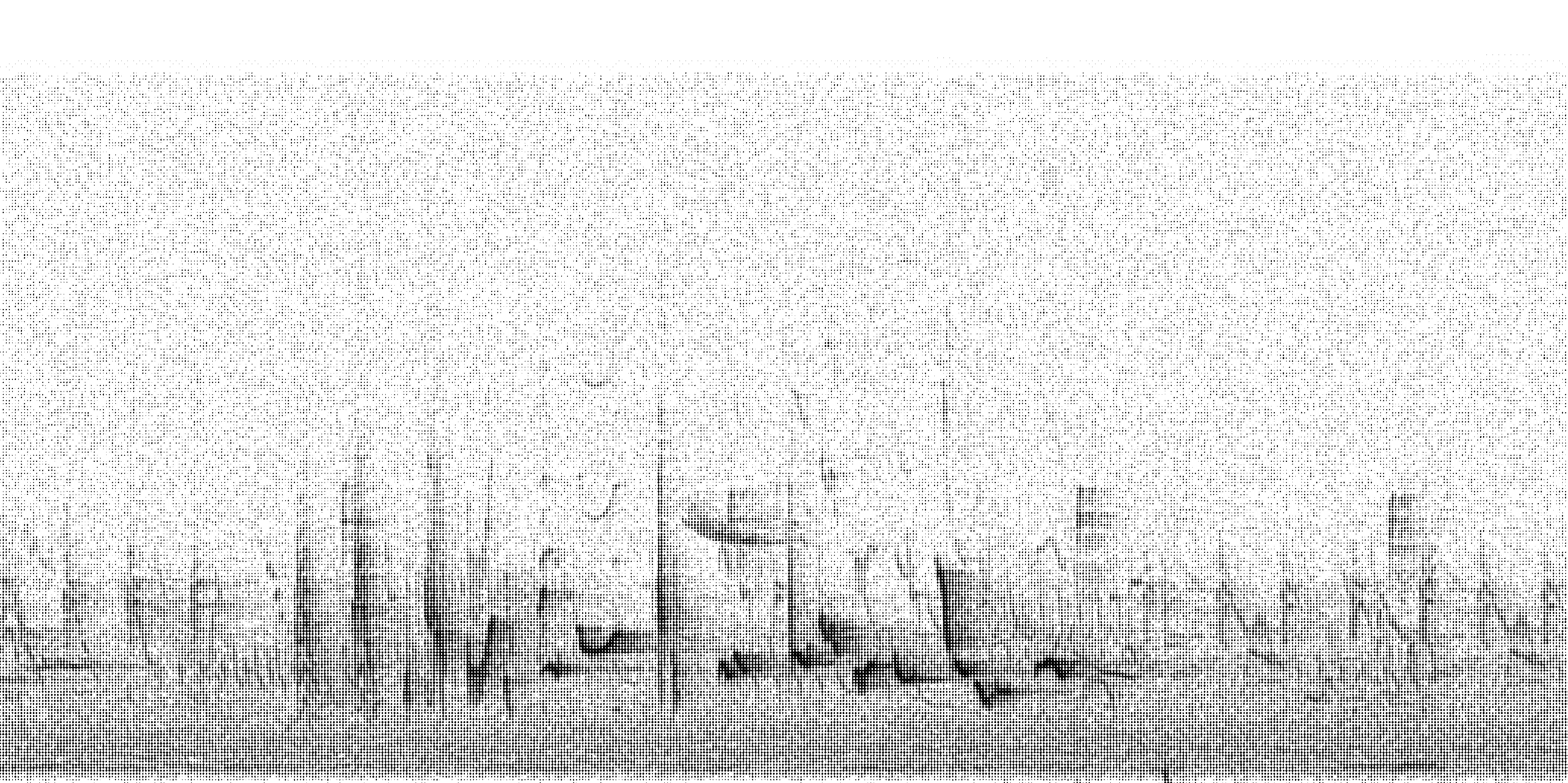
Mönchsgrasmücke
-

Rabenkrähe
-
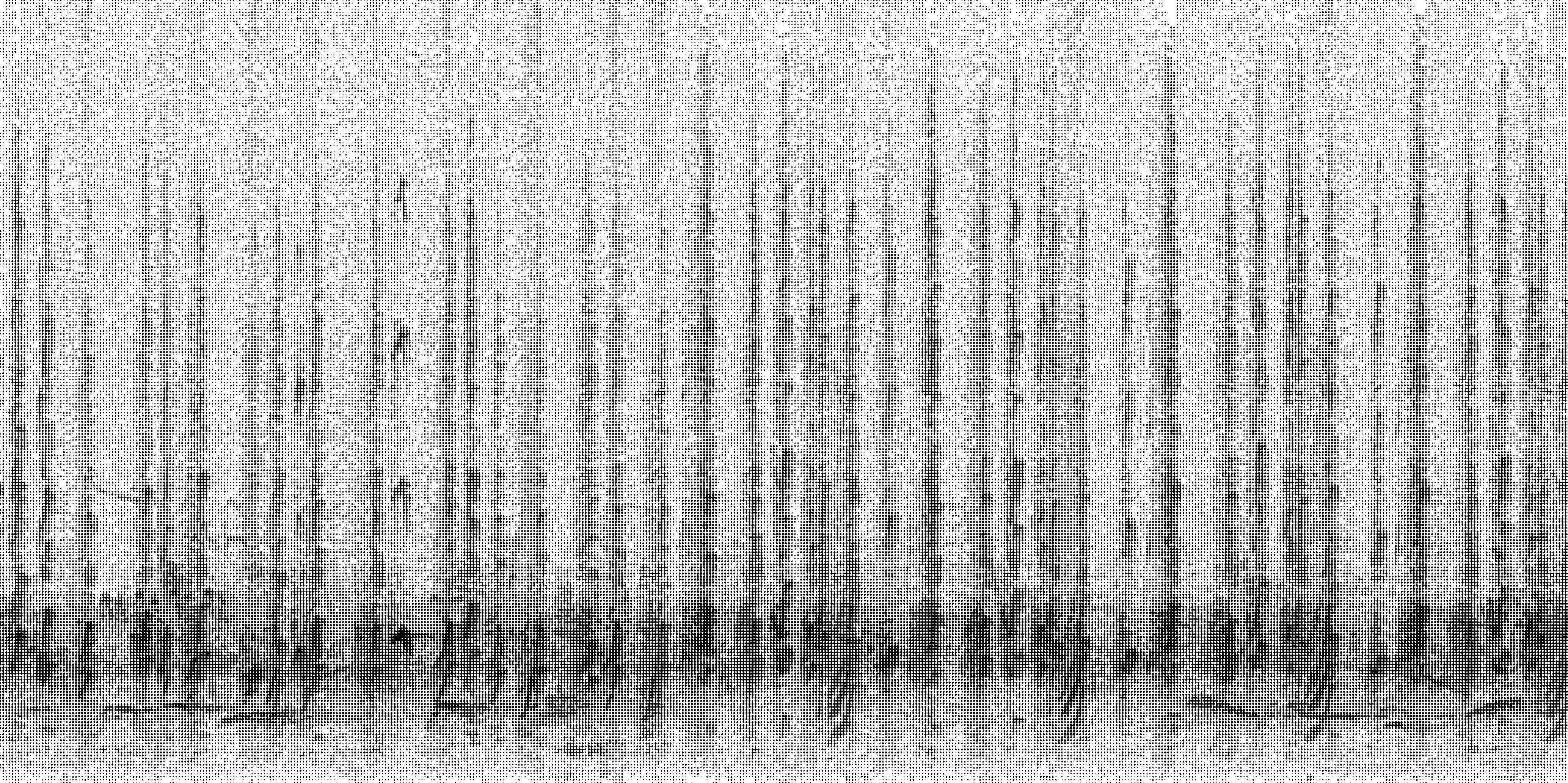
Rauchschwalbe
-

Ringeltaube
-

Rotkehlchen
-
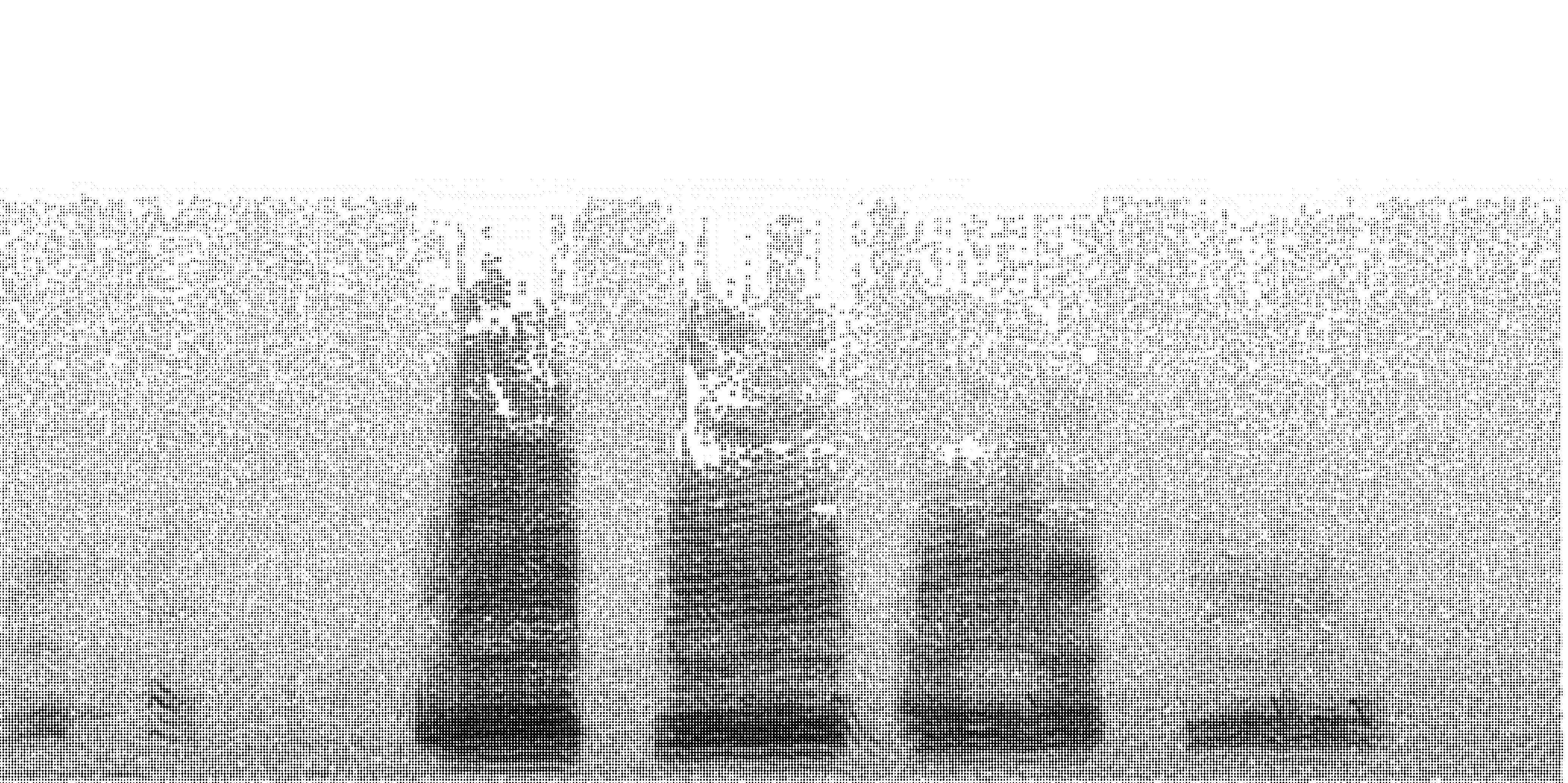
Saatkrähe
-

Schwanzmeise
-

Singdrossel
-
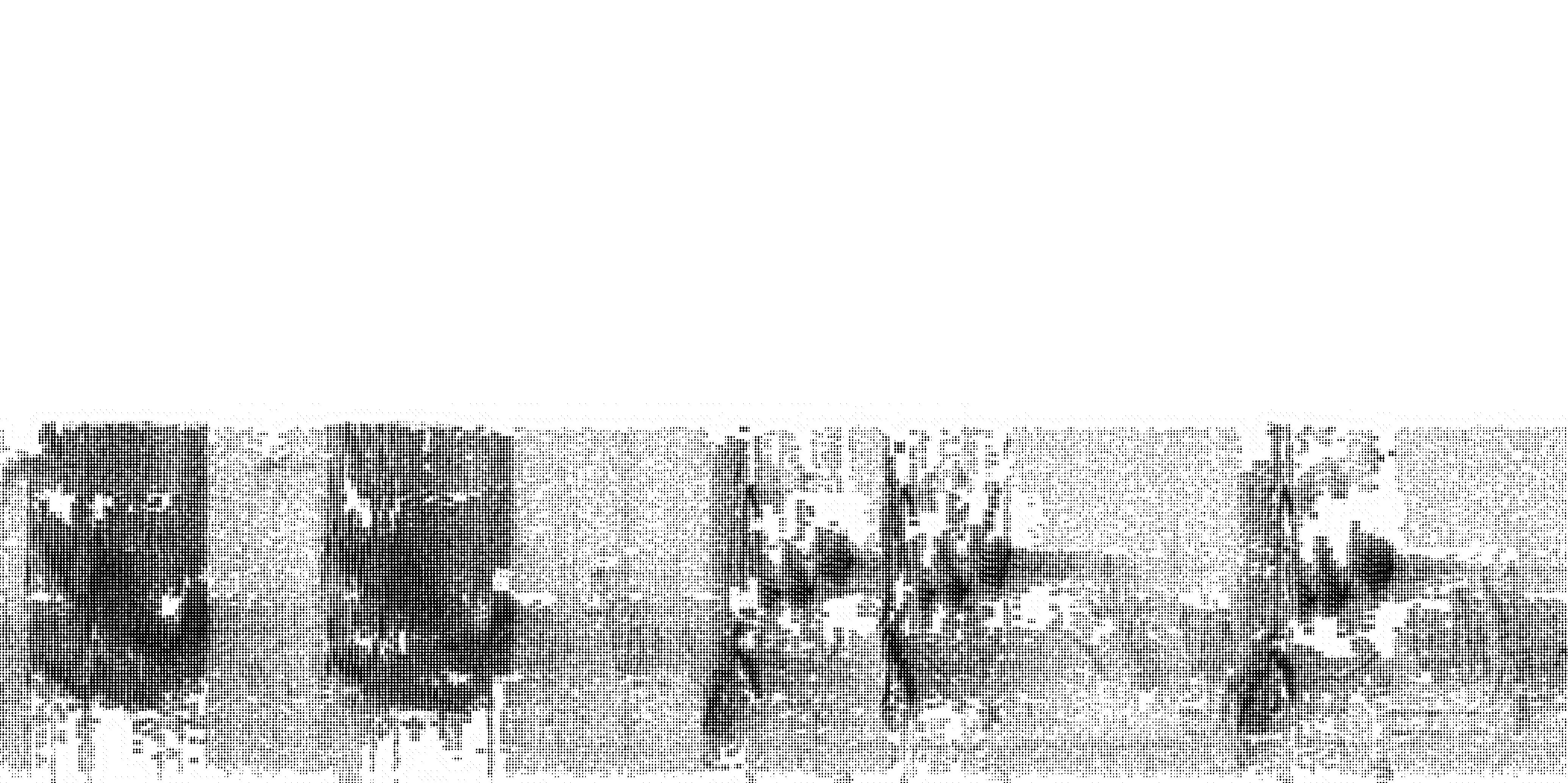
Star
-
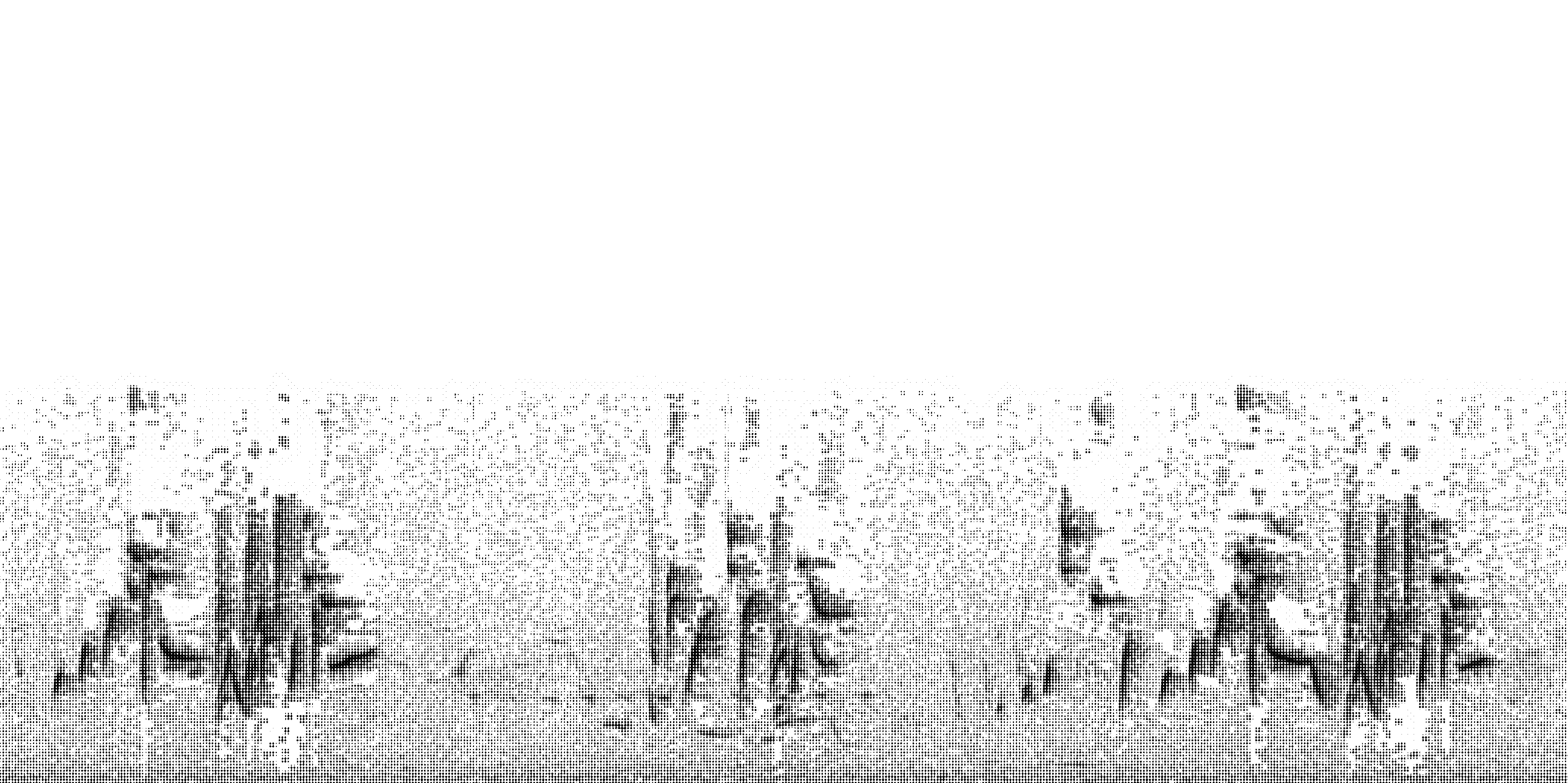
Stieglitz
-
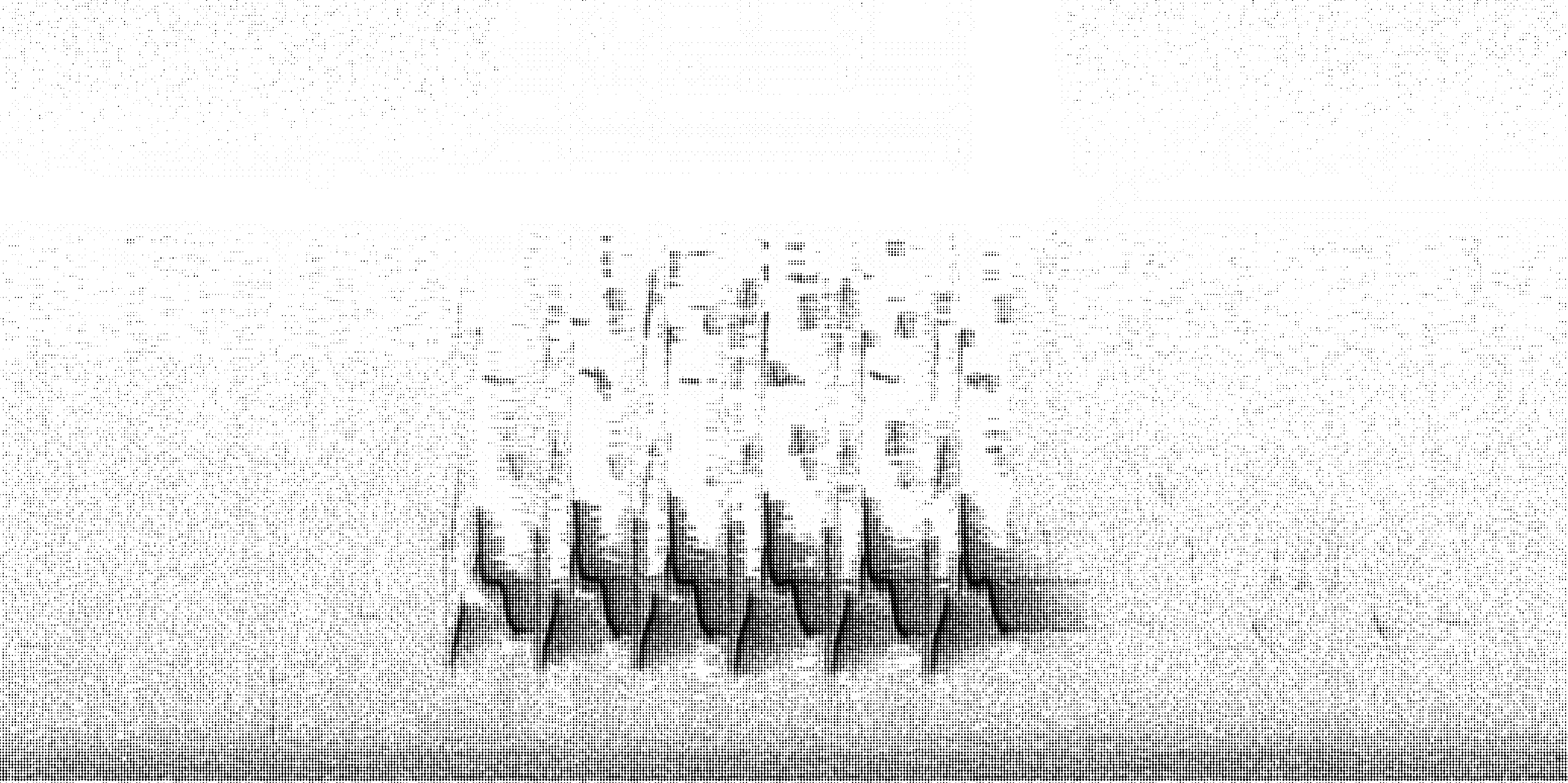
Tannenmeise
-
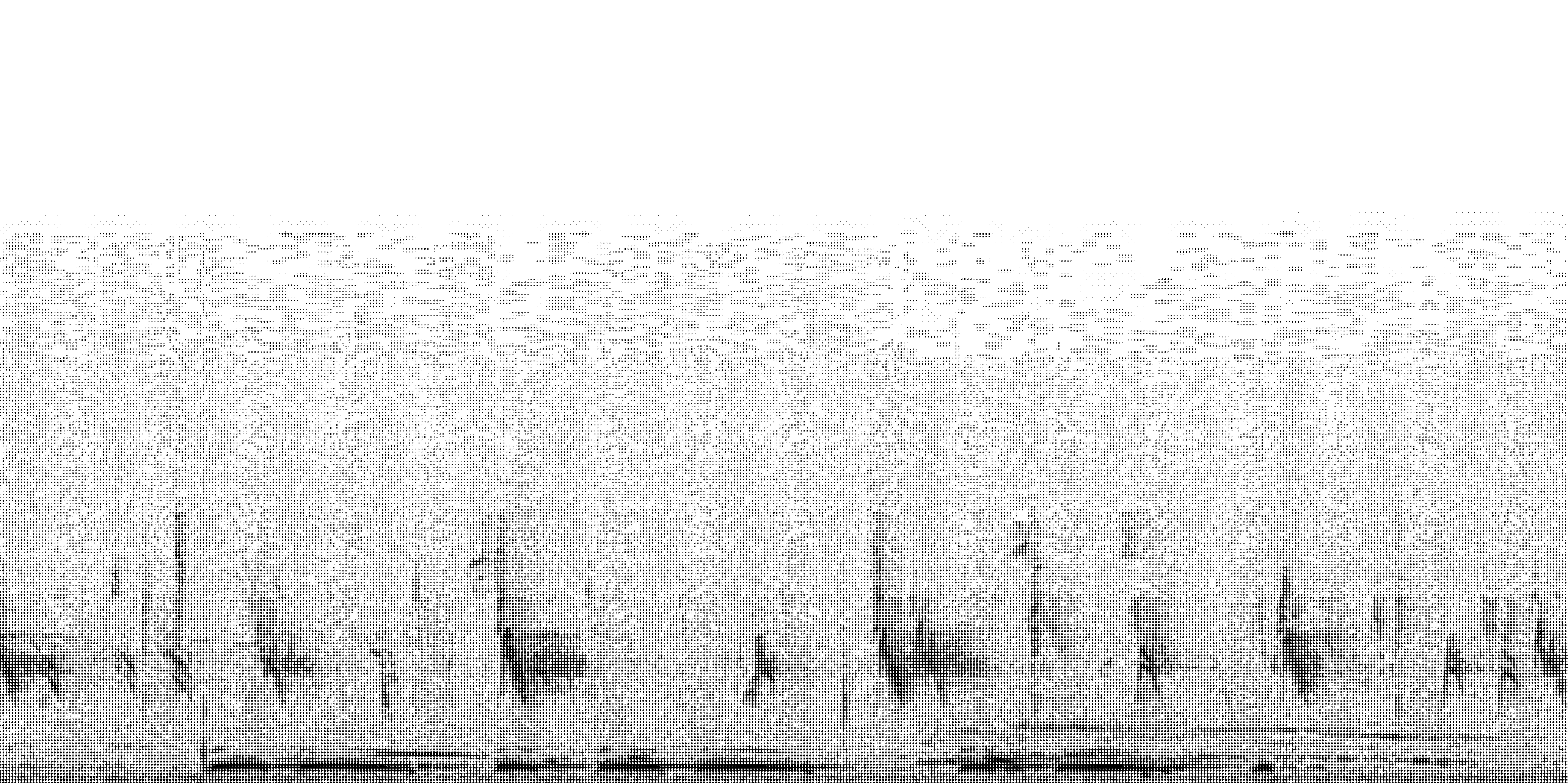
Türkentaube
-
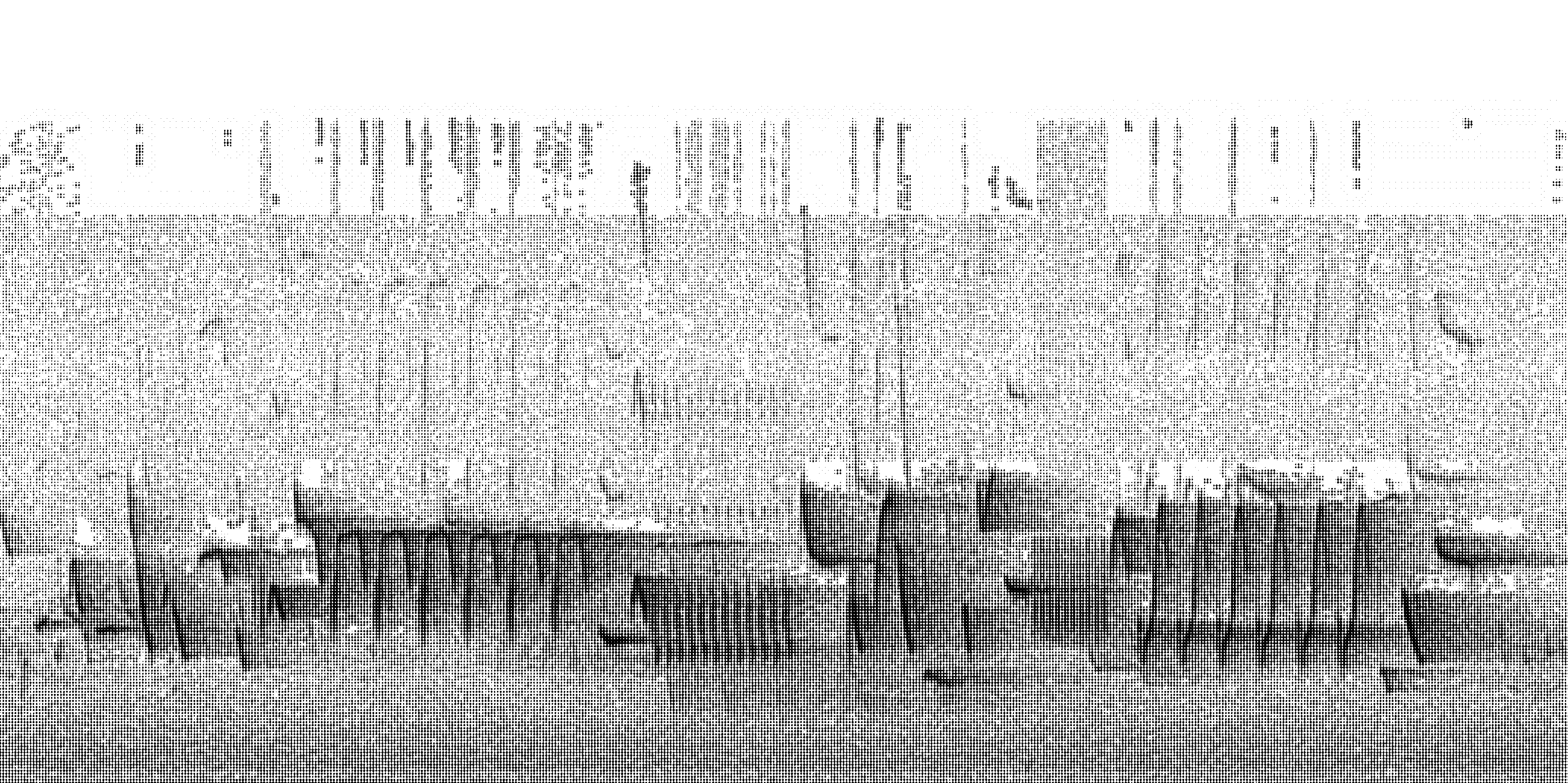
Zaunkönig
-

Zilpzalp
Die Amsel singt ihre Melodien sehr variantenreich in einem lauten, flötenden Ton. Man hört sie von den ersten milden Wintertagen bis in den Sommer.
Die Bachstelze singt ihren zweisilbigen Lockruf mit hoher, dünner, durchdringener Stimme.
Die Blaumeise singt meist ihr perlendes, hohes Lied: „zi zi zirrrr“ oder „si si jüüüü“. Dieses Motiv wird in unterschiedlichsten Variationen vorgetragen.
Der geschmetterte „Finkenschlag“ klingt meist wie: „zizizi zjazjazja di duwidja“. Es lassen sich allerdings viele Variationen unterscheiden. Eine typische Endung ist „würzgebier“. Namensgebend für die Finken ist der helle Ausruf: „pink“.
Dieses kräftige „Trommeln“ lassen besonders häufig unverpaarte Männchen im Frühjahr hören. Die typischen „kjick“ Rufe gibt der Buntspecht, zu unterschiedlichsten Anlässen das ganze Jahr über von sich.
Die kurzen hellen „kjäk“ Rufe werden einzeln oder gereiht gerufen. Sie sind in unterschiedlichen Abwandlungen Ausdruck der Stimmung der sozialen Vögel. Aus ihren Burtkolonien lassen sich auch schnärrende „ärrr“ und schnalzende „kkk“ Laute hören.
Dieses durchdringende, hell gequätschte Krächzen, das wie „räh“ oder „rätsch“ klingt, ist der Lock- und Warnruf des Eichelhähers. Im Frühling ist der leise, schwatzende Gesang zu hören. Typisch ist auch der „ga-hé“ Ruf.
Dieses harte „scháckackack“, wenn besonders erregt auch nur noch „kákakak“, ist der charakteristische Ruf der Elster. Manchmal singt sie auch leise schwätzend Knarr-, Pfeiff- und Krächzlaute in verschiedenen Tonhöhen.
Wenn viele Feldsperlinge, wie hier, gleichzeitig singen klingt es wie „knăknăknă...“. Typisch für die Art ist der kläffende Ruf, aber auch ein helles „uik“. Männchen umwerben mit einem halblauten „djoidjoidjoi...“ und erregt ruft der Feldsperling „titit, tetete“.
Das Lied des Fitis ist eine absinkende Reihe schwebener Pfeiflaute von etwas schermütigen Klang, etwa wie „dididi die düe düe dea dea deida da“. Abgesehen vom Lied ähnelt die Art dem Zilzalp in Aussehen und Rufen sehr.
Das Lied aus hohen klaren Tönen klingt wie „ti ti tirroiti“ und wird oft auch in einer um zwei oder drei Tönen längeren Variante gesungen. Ansonsten lässt der Gartenbaumläufer Pfiffe im gleichen Klang, wie „ti ti ti...“ hören.
Der Gesang der Gartengrasmücke ist kräftig und voll. Die etwas gurgelnden Töne sprudeln in schneller Folge heraus, wobei keiner besonders betont wird. Bei Beunruhigung sind tiefe und harte „tze“ oder „tzeck“ Rufe zu hören.
Das Lied beginnt mit einem langgezogenen Ton gefolgt von zwei, manchmal mehr, kurz angeschlagenen. Hier folgen vier schnelle Töne, in etwa wie „dih dededede“. Das Ende der Strophe ist variantenreich, bleibt allerdings meist recht kurz.
Der klangvolle Lockruf des Gimpels klingt wie ein weiches, flötendes „djü“ oder „düo“. Vorgetragen wird er einzeln oder in regelmäßigen Abständen.
Der klangarme Gesang des Girlitz bewegt sich zwischen zwei Tönen hin und her und wird in einem Zuge vorgetragen. Namengebend für den Girlitz ist der Flugruf „girlit“ oder „gitzzilrik“, der aber seltener zu hören ist.
Das Lied der Goldammer beginnt mit 5–10 gleichklingenden kurzen Tönen und endet mit ein oder zwei gestreckten Tönen, wobei der zweite meist tiefer liegt als der erste.
Das Lied der Goldammer beginnt mit 5–10 gleichklingenden kurzen Tönen und endet mit ein oder zwei gestreckten Tönen, wobei der zweite meist tiefer liegt als der erste.
Der Grünfink singt sehr variantenreich. Typisch für den Gesang ist das „Klingeln“ mit einem „djuih“ beendet. Häufig lässt er auch Pfeif- oder Kreischtöne hören. Oft spielt er mit den Gesangsbestandteilen und kombiniert sie zu halbfertigen Liedern.
Der Gesang besteht aus zwei Strophen. In der ersten wird der gleiche Ton 4–5 mal angeschlagen. In der zweiten folgt auf einen gepressten, zischenden Laut zwei Töne, die denen der ersten Strophe ähneln.
Das Reportoire des Haussperlings besteht aus schilpenden, kratzenden, zwischernden und schirkenden Lauten. In ihren Schlafgemeinschaften lärmen sie besonders in der Morgendämmerung und gegen Abend.
Der Gesang besteht aus auf- und absteigenden perlenden Tonketten, die durch gelegentliche Hebungen unterbrochen werden. Am Schluss singt die Tonhöhe etwas ab. Das Lied wird eilig und nicht sehr laut vorgetragen.
Der Gesang beginnt mit einer Reihe gedämpfter Töne, die eilig auf und ab schwanken. Auf diesen Vorgesang folgt die namensgebende klappernde Tonreihe, die schmetternd vorgetragen wird.
Der Gesang des Kleibers besteht aus lauten reinen Pfeiflauten, die zu einer Reihe verbunden werden. Häufig werden sie aufwärtsgerichtet vorgetragen, oft aber auch abwärts gerichtet. Typisch ist auch das „Klingeln“, bei dem die Töne schnell gereiht werden.
Die Kohlmeise singt variantenreich. Der typische „Schlag“ besteht aus einer monoton getakteten Wiederholung des gleichen Motivs. Häufig klingt es wie „zi zi bäh“. Hier ist es eher wie ein „vüdivüdi“. Der Ruf „si túit“ ähnelt dem der anderen Meisenarten.
Die schrillen Rufe der Mauersegler klingen wie „skrieh“ oder „sriesrie“. Sie werden mal höher und schärfer, mal tiefer und weniger durchdringend vorgetragen.
Die Rufe sind rauhe Stoßlaute, wie „dschrb“ oder „brrüd“. Bei Gefahr lassen sie höhere „zier zier...“ Rufe hören. Der Gesang ist härter und weniger melodiös als bei der Rauchschwalbe.
Auf den Vorgesang aus eiligem halblauten Gezwitscher folgt das Hauptmotiv, welches aus lauten, flötenden Tönen besteht. Diese werden lückenlos gebunden vorgetragen, in etwa wie: „diü tü tü diu tü diu tüo“.
Die krächzenden Rufe der Rabenkrähe, wie „krääh“, „kra“ oder „arrrg“ liegen in der Regel höher als die der Saatkrähe. Die Rufe der Nebelkrähe sind kaum von denen der Rabenkrähe zu unterscheiden.
Im Flug rufen sie einzeln oder locker gereiht „witt witt“. Die Rufe klingen manchmal auch wie „det“, „bit“ oder ein hohes „zi“. Der Warnruf ist ein durchdringendes „zili witt“ oder „ziwitt ziwitt“. Der leise zwitschernde Gesang vereint diese Töne mit Pfeif- und Schnurrlauten.
Der Gesang besteht aus drei gleichartigen vier- bis sechssilbigen Strophen, in etwa wie „(gru)grūhgrugrugru, gruhgrūhgrugrugru, gruhgrūhgrugrugrugug“. Das erste „gru“ wird sehr häufig weggelassen und am Ende der letzten Strophe gewissermaßen nachgeholt.
Der Gesang beginnt mit hohen halblauten scharfen Tönen. Darauf folgen perlende, meist abfallende Tonreihen und kurze Triller. Die einzelnen Perlstrophen werden von Pausen oder gestreckten Pfeiflauten getrennt.
Die Rufe der Saatkrähe sind heisere „krah“, „gäg“ und „kro“ Laute. Sie sind tiefer als bei der Rabenkrähe. Der Gesang besteht aus schwätzenden Lauten und knarrenden, kurzen „garrr garrr“-Reihen.
Häufig gibt die Schwanzmeise hohe, metallische Pfeiflaute wie „titītītie“ von sich. Außerdem typisch sind tiefe „zerrrr“ Rufe. Den Gesang, welcher der Kohlmeisenstrophe ähnelt, lässt sie eher selten hören.
Der variantenreiche, klangvolle Gesang besteht aus kurzen Tongebilden, welche zwei oder mehrere Male wiederholt werden. Die Motive werden hintereinanderweg vorgetragen. Typisch sind Pfeiftöne, die oft mit schrikenden und gepressten Lauten kombiniert werden.
Die Stimme des Stars ist sehr wandlungsfähig. Häufig lässt er ein gereihtes schrilles „Sprien“ hören, welches geraderaus, auf - und abwärtsgerichtet vorgetragen wird. Typisch sind auch „spett, spett...“ oder pfeifende „kjip, kjip, kjip...“ Rufe aber auch melodischere Tongebilde.
Namensgebend für den Stieglitz ist sein zweisilbiger Lockruf „didlit“. Beim schwätzenden Gesang wird das „didlit“ zu kurzen Liedern erweitert und oft mit einem heiseren, gezogenen Ton verbunden, etwa wie „didlit didlit didelit didelia zrih didelit didid irrr zrie...“.
Der zügige Gesang der Tannenmeise wird lückenlos vorgetragen und klingt etwa wie „witze witze witze“. Häufig lässt sie auch abgewandelte Formen hören. Der Lockruf ist ein kurzes hohes „dwi“, teilweise auch zwei- („dwii“) oder dreisilbig („dwii di“).
Der rucksende Ruf der Türkentaube ist ein dreisilbiges „gu gúh gu“, das meistens in langen Reihen vorgetragen wird. Die Tonhöhe bleibt dabei gleich und manchmal wird noch eine vierte Silbe an den Ruf angehängt.
Das Lied des Zaunkönigs beginnt oft mit 1–2 gestreckten Lauten, gefolgt von Reihen aus 3–6 geschmetterten Tönen, die durch gestreckte Laute voneinander getrennt werden. Das Motiv endet häufig mit einem kräftigen Roller, der an den „zerrr“ Ruf erinnert.
Der namensgebende Gesang des Zilpzalp besteht aus einer Folge gleichförmiger Töne, die alle nahezu gleich hoch sind, etwa wie „djilm djelm dem djem...“ oder „zilp zalp zilp zalp...“